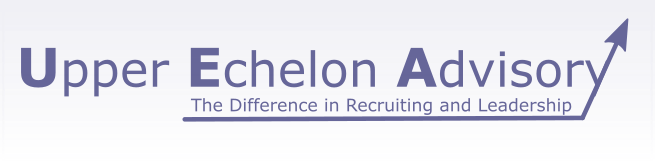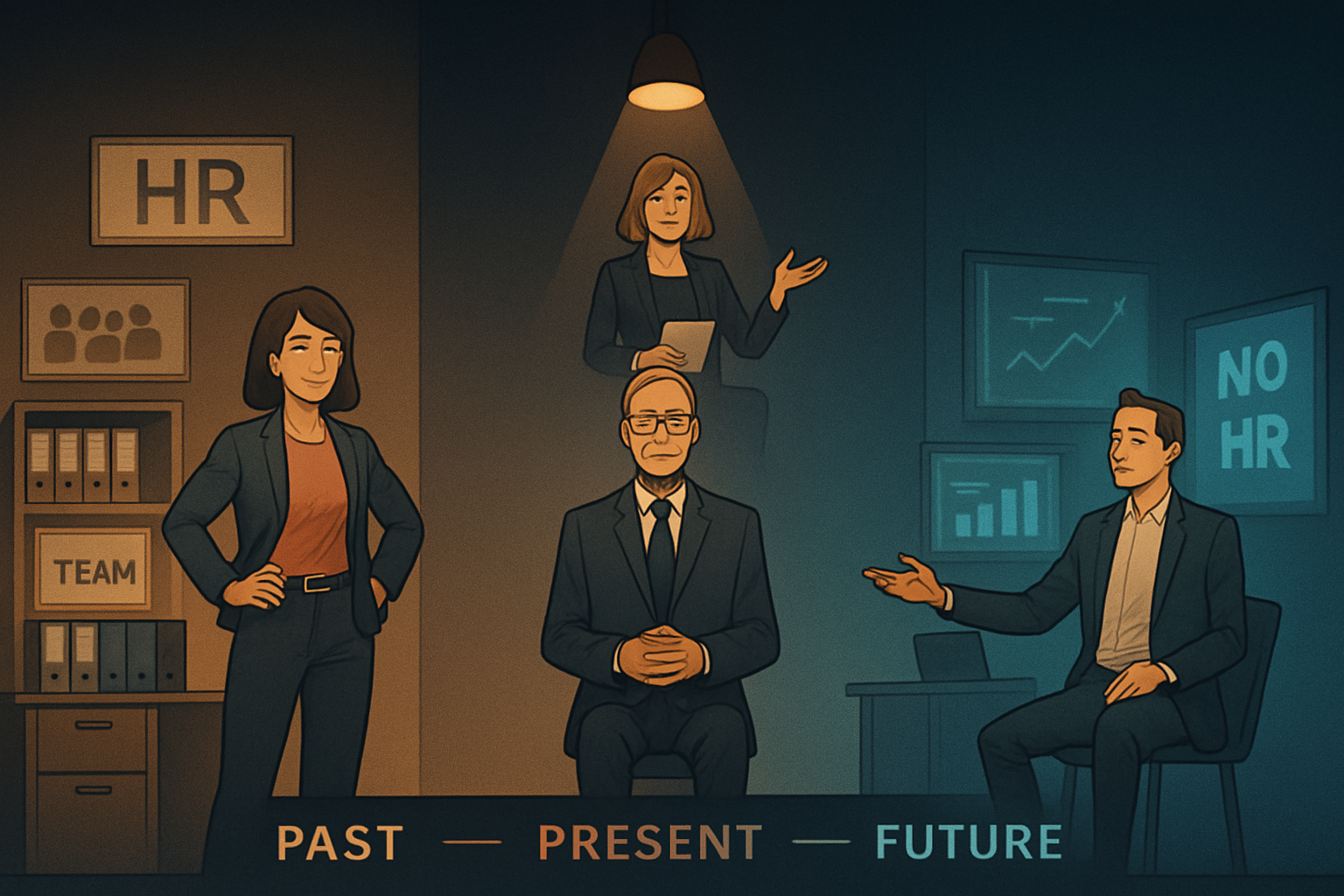Unsere aktuellen Newsletter

In den letzten Jahrzehnten galten charismatische und transformationale Führung als das Ideal moderner Führung. Doch schon früh warnten teilweise die Gleichen Forscher (wie z.B. Bernard Bass und Jay Conger) davor, dass diese Art von Führung auch eine „dunkle Seite“ hat. Was, wenn Charisma zur Manipulation wird? Wenn Machtstreben nicht dem Gemeinwohl, sondern dem Ego dient? (Dabei weiß die Wissenschaft, dass gerade Männer anfälliger für egoistisch-geprägten Machtmissbrauch sind, während Frauen Macht eher prosozial nutzen.) Willkommen in der Welt der destruktiven Führung. ________________________________________ ⚠️ Was ist destruktive Führung? Destruktive Führung ist kein Ausrutscher, kein Burnout, kein schlechter Tag. Sie ist ein wiederkehrendes, bewusstes und höchst-schädigendes Verhaltensmuster, das dem langfristigen Interesse der Organisation und ihrer Mitarbeitenden entgegenwirkt. Dabei ist sie oft schwer zu erkennen – denn destruktive Führung tarnt sich. Sie tritt charismatisch, zielorientiert, durchsetzungsstark auf. Vorgesetzte erkennen solches Verhalten regelmäßig genau aus diesen Gründen nicht und sind nicht selten überrascht, dann doch davon zu erfahren. Und genau das macht sie so gefährlich. Denn destruktive Führung funktioniert zumindest kurzfristig überraschend gut: ✅ Sie bringt schnelle Entscheidungen ✅ Sie zieht loyale (oder abhängige) Gefolgschaft an ✅ Sie erscheint stark in Krisen Doch langfristig: ❌ sinkt die Innovationskraft ❌ steigt die Fluktuation ❌ leidet das Vertrauen ❌ verroht die Unternehmenskultur ________________________________________ 🕵️ Das toxische Dreieck: Führung, Gefolgschaft und Kontext Die Forschung von Padilla, Hogan & Kaiser (2007) zeigt, dass destruktive Führung nicht allein durch den Charakter der Führungskraft erklärt werden kann. Vielmehr ist sie das Ergebnis eines toxischen Zusammenspiels: Destruktive Führungspersonen – Machtbesessen, manipulativ, impulsiv / Oft mit dunklen Persönlichkeitseigenschaften (Dark Triad) Anfällige Gefolgschaft – Unsichere, abhängige oder unkritische Mitarbeitende / Wunsch nach starker Führung oder Zugehörigkeit Begünstigende Umgebungen – Unsichere Strukturen, instabile Organisationen / Fehlende Kontrolle, schlechtes HR-Management Diese Kombination führt zur Normalisierung von toxischem Verhalten – bis es zu spät ist. Es liegt also nicht nur an schlechten Führungskräften, sondern bedarf Mitarbeiter, die sich nicht zu wehren wissen und eine umgebende Struktur, die sowohl das schlechte Führungsverhalten ignoriert als auch schwache bzw. nicht aufbegehrende Mitarbeiter. (Wir hatten diesen Aspekt in einem unserer vergangenen Newsletter - No good Leadership without good Followership - bereits thematisiert: https://www.linkedin.com/pulse/good-leadership-without-followership-starke-gefolgschaft-eqrre) Wenn wir auf destruktives Führungsverhalten fokussieren, nimmt die sogenannte Dark Triad (Dunkle Triade) einen wichtigen Platz ein. Sie besteht aus drei Persönlichkeitsmerkmalen, die besonders häufig mit destruktivem Führungsverhalten assoziiert werden: 1. Narzissmus • Großes Bedürfnis nach Bewunderung • Geringe Empathie • Überhöhtes Selbstbild • In Unternehmen: charmant, visionär, aber kaum kritikfähig ➡️ Beispielverhalten: „Ich weiß es besser“, „Ohne mich läuft hier nichts.“ ________________________________________ 2. Machiavellismus • Strategisch kalkulierend • Manipulativ • Zweck heiligt die Mittel • Im Management oft effektiv – aber ohne ethischen Kompass ➡️ Beispielverhalten: „Solange das Ziel erreicht wird, ist jedes Mittel erlaubt.“ ________________________________________ 3. Psychopathie (subklinisch) • Keine Schuldgefühle, keine Angst • Oberflächlich charmant, aber emotionskalt • Risikofreudig und impulsiv • Im Job oft gefährlich, weil schwer zu durchschauen ➡️ Beispielverhalten: „Wenn jemand dabei untergeht – nicht mein Problem.“ ________________________________________ 🌗 Zwischen Licht und Schatten: Die helle Seite dunkler Führung Ein zentrales Problem destruktiver Führung ist nicht, dass sie von Anfang an als „böse“ erkannt wird. Ganz im Gegenteil: Viele ihrer Merkmale zeigen sich anfangs als wirksame, bewunderte oder sogar gewünschte Führungseigenschaften. Erst später offenbart sich ihr destruktives Potenzial. Deshalb lohnt ein genauerer Blick auf die drei zentralen Dimensionen der dunklen Triade – und ihre ambivalente Erscheinung in Organisationen: Narzissmus: Zwischen Inspiration und Selbstsucht Narzisstische Führungskräfte wirken häufig zunächst charismatisch, visionär und überzeugend. Sie haben ein starkes Bedürfnis, Großes zu leisten und von anderen bewundert zu werden – was sie antreibt, ambitionierte Ziele zu setzen und hohe Standards zu vertreten. Auf der hellen Seite zeigen sich: Selbstbewusstsein: Narzissten haben oft keine Angst vor Verantwortung. Sie treten entschlossen auf und geben klare Richtung vor. Motivationskraft: Ihre Begeisterung kann andere anstecken und motivieren, über sich hinauszuwachsen. Strategisches Denken: Sie sind häufig sehr auf Wirkung und Außenwahrnehmung bedacht – was in Positionen mit Repräsentationsfunktion durchaus hilfreich sein kann. Doch diese Stärken kehren sich schnell ins Gegenteil, wenn sie nicht durch Selbstreflexion oder Feedback reguliert werden. Dann zeigt sich die dunkle Seite: Empfindlichkeit gegenüber Kritik Überhöhte Selbstdarstellung Ausbeutung anderer zur eigenen Profilierung Die Balance ist entscheidend: Narzissmus kann antreiben – oder das Team zerreißen, wenn nur noch die Selbstdarstellung zählt. Machiavellismus: Zwischen kluger Strategie und moralischer Kälte Machiavellistische Führungspersönlichkeiten zeichnen sich durch hohes taktisches Gespür aus. Sie sind meist analytisch denkend, zielorientiert und verstehen es, komplexe Dynamiken politisch zu navigieren. Ihre helle Seite ist im Management häufig willkommen: • Strategische Klarheit: Sie denken mehrere Schritte voraus, erkennen Machtverhältnisse und gestalten Organisationen oft effizient. • Verhandlungsgeschick: In heiklen Situationen finden sie Lösungen, die anderen verborgen bleiben. • Risikokompetenz: Machiavellisten agieren nicht aus Angst, sondern kalkulieren Nutzen und Risiken nüchtern. Doch ohne ethischen Kompass kippt diese Fähigkeit in manipulatives Verhalten: Zynismus, der jede moralische Schranke ignoriert Instrumentalisierung von Menschen als bloße Mittel zum Zweck Doppelbödige Kommunikation, die Vertrauen zerstört In stabilen, geregelten Organisationen kann eine „milde Form“ des Machiavellismus sogar nützlich sein – etwa beim Umgang mit schwierigen Interessenkonflikten. In unsicheren, entgrenzten Kontexten aber wird daraus schnell schädlicher Opportunismus. Subklinische Psychopathie: Zwischen Furchtlosigkeit und Gefühllosigkeit Psychopathie im Arbeitskontext zeigt sich selten als extremes, kriminelles Verhalten – viel häufiger begegnet uns die subklinische Variante: Menschen mit hoher Impulskontrolle, gleichzeitig aber geringer Empathie, emotionaler Kühle und hoher Risikobereitschaft. Ihre hellen Seiten können beeindruckend wirken: Krisenresistenz: Sie behalten auch in chaotischen Situationen einen kühlen Kopf. Furchtlosigkeit: Entscheidungen werden nicht von Angst bestimmt, sondern von rationaler Einschätzung. Durchsetzungsfähigkeit: Sie lassen sich selten von Widerständen aufhalten – das kann Projekte voranbringen. Aber: Wo keine Empathie, keine Verantwortung und kein Moralgefühl existieren, wird der Nutzen zur Gefahr: Unbarmherzige Entscheidungen ohne Rücksicht auf Mitarbeitende Grenzüberschreitungen im Umgang mit Macht Fehlende Reue bei Fehlverhalten – was Lernen und Veränderung blockiert Kurz gesagt: Diese Form der Führung wirkt im Ernstfall „funktional“, aber entmenschlicht die Organisation. ________________________________________ 💡 Was HR und Führungskräfte jetzt tun können Destruktive Führung entsteht nicht im luftleeren Raum. Wenn wir über Dark Leadership sprechen, geht es nicht darum, Persönlichkeitsmerkmale per se zu verurteilen. Es geht vielmehr darum, ihre Ambivalenz zu erkennen: Führungseigenschaften wie Charisma, strategisches Denken oder emotionale Kontrolle sind wertvoll – aber nicht neutral. Ohne Feedback, Werteorientierung und strukturelle Checks kann aus Stärke schnell Machtmissbrauch werden. Das Problem ist nicht die Eigenschaft allein, sondern ihr Kontext, ihre Einbettung und ihr Umgang mit Verantwortung. Hier sind konkrete Schritte, um Organisationen zu schützen und destruktives Führungsverhalten zu kanalisieren: Früh erkennen – Persönlichkeitstests verantwortungsvoll nutzen Persönlichkeitsinventare können helfen, destruktive Neigungen zu erkennen – aber sie müssen kontextsensibel interpretiert werden. Feedbackkultur etablieren 360°-Feedbacks, Exit-Interviews und Kulturmessungen zeigen auf, wo dunkle Führung wirkt; das Konzept der Psychologischen Sicherheit (siehe Newsletter: https://www.linkedin.com/pulse/psychologische-sicherheit-mut-zur-meinung-und-klmsf) kann hierbei stark entgegentreten. Führungskräfteentwicklung mit Ethik- und Werte-bezug Nicht nur Kompetenzen – auch Selbstreflexion, Integrität und Demut müssen Teil jedes Leadership-Programms sein. Starke HR-Compliance-Strukturen Toxische Führung gedeiht dort, wo niemand hinsehen will. Deshalb: Whistleblower-Schutz, Vertrauenspersonen, klare Sanktionen. ________________________________________ Fazit Führung ist nicht per se gut. Je größer die Macht, desto wichtiger die Verantwortung – und die strukturelle Einbettung von Kontrolle, Ethik und Feedback. Je dunkler die Persönlichkeit, desto wichtiger individuelle Verhaltenstrainings und Selbst-Führung. Die dunkle Seite der Führung ist real. Doch nur wer sie erkennt, kann ihre Dynamiken durchbrechen – und Organisationen schaffen, die nicht auf Angst, sondern auf Vertrauen basieren. Also, wie identifiziert und bewertet Ihre HR-Abteilung Führungskräfteverhalten? Wie sehr erkennen Sie ggf. Ansätze dunkler Führung in sich selbst? Wo erkennen Sie Optimierungspotenzial? Im nächsten – etwas anderen - Newsletter: "Braucht es HR überhaupt noch? – Zwischen Strategie, Tagesgeschäft und radikalem Wandel" Podiumsdiskussion in 3 Akten

Führungstrainings kosten – und zwar richtig. Aber liefern sie auch den versprochenen Mehrwert? Studien sagen: Ja – aber nur, wenn sie richtig gemacht sind. Der Großteil der HR-Ausgaben für innerbetriebliche Weiterbildung der Mitarbeiter wird für Führungskräfte aufgewendet. Glücklicherweise ist dies nicht unbegründet, den Metastudien zeigen durchaus beachtliche Effektstärken (von durchschnittlich über .6): Investitionen in Wissen und Fähigkeiten von Führungskräften sind also betrieblich lohnend. Doch worauf sollten HR-Experten bei der Vergabe von Führungskräfte-Trainings bzw. der Auswahl eines Führungskräfte-Trainers achten? Eine gute HR-Abteilung braucht hierzu „nur“ in die Schublade zu greifen und dann eine entsprechende Liste herauszuziehen. Doch die Erfahrung lehrt, dass selbst sehr gute HR-Abteilungen eine solche Liste schlichtweg nicht (immer) haben! Allzu oft entscheiden Hörensagen, Bauchgefühl oder der schöne Webauftritt eines Trainers. Doch das reicht nicht – zumindest nicht, wenn man Wirkung erzielen will. Was sagt die Wissenschaft? In der Literatur findet man zur Konkretisierung des Training-Erfolgs regelmäßig die folgenden Kriterien (im Original bei Kirkpatrick zu finden): Rückmeldungen der Teilnehmer Lernerfolg Verhaltensänderung / Transfer in die tägliche Praxis (messbare) Leistungssteigerung Spätere Studien belegten, dass gerade die unteren beiden Stufen – für die Praxis – kaum relevante Indikatoren darstellen. Zur Klarstellung und in Klartext: Teilnehmer nach einem Seminar, Training oder Workshop (oft standardisiert mit Antworten zum Ankreuzen) zu befragen, wie die Veranstaltung denn so war, ist nicht wirklich die Mühe wert! Doch was machen so ziemlich alle Anbieter, die etwas auf sich zählen? Und worauf verlassen sich sowohl die Anbieter selbst als auch HR-Abteilungen, welche Mitarbeiter entsenden? Richtiiiig: Auf von Teilnehmern im Nachgang ausgefüllte Standard-Evaluationsbögen. Dabei weiß die Wissenschaft, dass deren Aussagekraft höchstens für ganz schlechte Veranstaltungen etwas taugt. Ziemlich sicher hat jeder von uns diese Bögen nach einem 2 oder 3 Tages-Seminar oft genug in aller letzter Minute (der Dozent hat zwar noch irgendetwas erzählt, aber die Unterlagen waren schon alle weggepackt und jeder wollte nur noch seinen Zug oder das Taxi zum Flughafen erreichen) noch schnell mit Kreuzchen versehen. Wir alle haben eigene Mitarbeiter nach dem Seminar schon befragt, wie es denn war, und die Rückmeldungen beginnen alle immer recht flach und wohlwollend. Nur bei konkreten Rückfragen kommt etwas Licht ins Dunkel… Aussage-schwächer geht´s kaum; das Konzept der sozialen Erwünschtheit lässt grüßen! Ähnliches wissen wir zur zweiten Kategorie „Lernerfolg“ zu sagen: Das Abfragen von Fakten oder auch das Beantworten von Transfer-Fragen ist in Schule, Studium und Weiterbildung ein oft eingesetztes Mittel; genauer, das einzige. Aber auch hier bleibt der nachhaltige Erfolg oft aus. (Verkürzt lässt sich das mit dem Schlagwort Bulimie-Lernen charakterisieren.) Erst auf den Stufen 3 und 4 können wir die Qualität eines guten Trainings einigermaßen sicher begutachten. Doch das ist mit (zusätzlichem) Aufwand verbunden… Dass die Einsparung dieses Aufwandes jedoch doppelt und dreifach den Lernerfolg und Lerntransfer ausbremst, scheint kaum zu interessieren… Somit werden munter weiter Evaluationsbögen am Seminarende verteilt und ausgefüllt oder scheinbar Qualität mittels einer Abschlussprüfung abgebildet… Betriebliche (Weiter-)Bildung hat das primäre Ziel, dass das dadurch Erworbene auch praxiswirksam zum Nutzen der Firma eingesetzt wird. Diese Praxiswirksamkeit lässt sich aber nicht durch Evaluationsbögen oder Abschlusstests nachweisen. Vorgreifend auf Stufe 4 lässt sich verkürzt so darlegen: Wenn ein Unternehmen ohne betriebliche (Weiter-)Bildung 1 Mio Umsatz (oder Gewinn) ausweist, dann sollte es mit betrieblicher (Weiter-)Bildung 1 Mio Umsatz (oder Gewinn) plus Kosten der Weiterbildung plus x erzielen. Denn ohne dieses Plus lohnt sich das Investment schlichtweg nicht. Etwas BWL-lastiger formuliert: betriebliche (Weiter-)Bildung muss einen messbaren ROI – Return on Investment – liefern. Der Teufel steckt natürlich im Detail – nicht alle Trainings sind gleich und manchmal kommen Mitarbeiter auch aus eher persönlichen Vorlieben heraus oder im Zuge persönlicher Anerkennung in den Genuss von Trainings. Aber sind ihre HR-Vertreter auf Stufe 4 ggü. der Geschäftsleitung regelmäßig in der Lage, nachweisen zu können, erfolgreich aus- und weitergebildet zu haben? Warum nicht – und wie weit davon entfernt sind ihre HR-Experten? Wem diese ROI-Sache nicht ganz geheuer erscheint, sollte zumindest eine Verhaltensänderung nach einem Training feststellen können bzw. wollen. Dies kann durch Beobachtung und Befragung sowohl unstrukturiert – z.B. ein kurzes, direktes Gespräch - oder mit klaren Vorgaben standardisiert – z.B. mittels Fragebogen zu spezifischen Verhaltensweisen an mehrere betroffene Mitarbeiter verteilt - erfolgen. Der Königsweg: Systematisch messen – und vergleichen! Ein wichtiger Schritt laut Kirkpatrick besteht in der Erstellung von Vergleichsgruppen. So sollte doch gerade auf den Stufen 3 und 4 zumindest im direkten Vergleich zusätzlich aus- und weitergebildete Mitarbeiter im Verhalten oder gar messbaren Leistungsindikatoren besser abschneiden als solche ohne zusätzliches Training. Wobei ich an dieser Stelle unbedingt nochmals die bereits im ersten Satz angedeutete Lanze für solche Investitionen brechen möchte: Selbst wenn der Vergleich nicht positiv zu bewerten wäre, sollte die Konsequenz nicht darin liegen, keine Trainings mehr durchzuführen, sondern bessere! Was ein gutes Führungskräfte-Training ausmacht Folgend wird konkret für das Thema Führungskräfte-Weiterbildung dargelegt, auf was HR achten sollte, um Qualität eines Führungskräfte-Weiterbildungsangebotes zu erkennen bzw. sicherzustellen und darüber hinaus auch möglichst hohen Praxistransfer zu gewährleisten. Denn nur wenn das Erlernte auch langfristig in den eigenen Führungsalltag integriert wird und nachhaltig das eigene Führungsverhalten verändert, hat sich die Investition in das Führungskräfte-Training gelohnt. Gutes Leadership-Training umfasst daher gleichermaßen die Vermittlung von Wissen, die Befähigung zu bestimmtem Verhalten und das Anwenden dieser Fähigkeiten. Die Metastudie von Lacerenza et al. (2017) analysierte 335 Einzelstudien und gibt klare Hinweise, worauf HR achten sollte. Hier die wichtigsten Empfehlungen, um positiven Effekte einer guten Leadership-Weiterbildung abgreifen zu können: Analysieren Sie die konkreten Bedürfnisse der Teilnehmer - Umso genauer die Passung zwischen Teilnehmern und Inhalten, umso besser fühlen sich diese angesprochen und dementsprechend werden höhere Effekte im Lernen und dem nachhaltigen Praxistransfer erzielt. Nutzen Sie das Feedback vorangegangener Maßnahmen – Obgleich ich in meinem letzten Artikel das Konzept der sozialen Erwünschtheit anführte, sollte daraus nicht geschlussfolgert werden, keine Rückmeldungen von den Teilnehmern einzufordern. Im Gegenteil, stellen Sie Absolventen von Trainings gute Fragen und lassen Sie deren Antworten für künftige Trainings (und deren Inhalte sowie Umsetzung) nicht unberücksichtigt. Nutzung unterschiedlicher, sich ergänzender Trainingsmethoden - Reiner Frontalunterricht, ohne Interaktion, Selbstlern-Elementen oder gar Übungsanteilen sind unbedingt zu vermeiden; gerade ein hoher Praxisbezug und somit die Möglichkeit des Einübens von Fähigkeiten und Verhalten in der Praxis sind essentiell für Führungskräfte-Trainings. (Leider erfahre ich immer wieder von – sehr teuren – Trainings gänzlich ohne Praxisanteil. Dann empfehlen sich zumindest Rollenspiele; welche aber bekanntermaßen nicht alle Teilnehmer ansprechen…). Letztlich muss gerade bei Verhaltensändernden Trainings ausreichend Raum+Zeit für Diskussionen vorgesehen werden. Gute Trainer geben Feedback (und gute Teilnehmer verlangen danach) - Wenn wir den eben klargestellten Nutzen von Diskussionen und Praxisbezug inkl. Übung erkennen, dann wird deutlich, wie wichtig Feedback der Trainer an die Teilnehmer ist: es regt die Selbstreflexion und die kognitive Auseinandersetzung an; wirkt korrigierend auf suboptimales Verhalten und bestärkt wünschenswerte Verhaltensmuster. Strecken Sie Trainingseinheiten – geballte Seminare, gar im Sinne eines BootCamps, verringern den Lernerfolg und die Chancen auf langfristige Verhaltensänderungen erheblich; Wissensvermittlung und Übungseinheiten profitieren sehr von über einen längeren Zeitraum gestreckten Trainings (die sog. Cognitive Load Theory – CLT – liefert Ihnen weitere Einzelheiten). Gerade in Bezug auf positive Resultate auf der organisationalen Ebene zeigen sich Vorteile zeitlich gestreckter Programme. Führen Sie die Trainings eher in Präsenz (nicht virtuell) und am Arbeitsort (und nicht „offsite“ in coolen Tagungshotels) durch – virtuelle Trainings stellen erhöhte Anforderungen an die Teilnehmer und Trainer dar und beschränken die Möglichkeiten des informellen Austausches, vor allem aber der praktischen Umsetzung. Während virtuell durchaus Wissen vermittelt werden kann, zeigen Studien, dass ein Transfer (in die Praxis) bei virtuellen Trainings kaum gelingt. Training am Arbeitsort ist vor allem bzgl. höherer Resultate für das Unternehmen relevant, und weniger wichtig bis unbedeutend für Wissensvermittlung und/oder Transfer in die Praxis. Sanktionieren Sie Abwesenheit – die aktive Teilnahme über die gesamte Dauer des Trainings ist Pflicht und selbst in Teilen nicht verhandelbar. Selbstverständlich kann es passieren, dass die Bahn etwas Verspätung hat oder die Parkplatz-Suche ein paar Minuten länger dauerte. Doch hier sind im Zweifel enge Grenzen zu ziehen. Denn selbstverständlich wirkt sich Abwesenheit gerade bei guten Trainings sehr schnell auf Wissen und Transfer in die Praxis aus. Es gibt gewichtige Gründe, warum für ein Training, Workshop oder Seminar eine bestimmte Zeit veranschlagt wird. Nebenbei wirkt es auch nachweislich negativ auf andere Teilnehmer… Die Ergebnisse guter Führungskräfte-Trainings in Zahlen: Laut der Metaanalyse von Lacerenza et al. (2017) lassen sich durch gut konzipierte Programme folgende durchschnittliche Effekte erzielen (jeweils im Vergleich zu mittelmäßigen Programmen): +25 % im Wissenserwerb (Lernerfolg) +28 % im Verhaltenstransfer in die Praxis +25 % in der organisatorischen Wirkung Effektstärken von bis zu 0,82 – ein beeindruckender Wert in der Bildungsforschun g Fazit: Qualität entscheidet – und HR hat den Hebel in der Hand Beachtlich, was gutes Führungskräfte-Training ausrichten kann – und welches Potenzial bei schlechten oder mittelmäßigen Angeboten auf der Strecke bleibt! Wer diese Empfehlungen umsetzt und bei der Auswahl sowie Gestaltung von Führungskräfte-Weiterbildungsangeboten beachtet, spielt künftig in einer höheren Liga. Denn Führungskräfte-Trainings sind kein Selbstzweck. Wenn Sie mit Ihrem Weiterbildungsbudget echten Mehrwert schaffen wollen, setzen Sie auf Qualität – und prüfen Sie Programme systematisch anhand der oben genannten Kriterien. Dann rechnet sich die Investition – für Führungskräfte, HR und das gesamte Unternehmen. Also, wie identifiziert und bewertet Ihre HR-Abteilung Führungskräfte-Weiterentwicklungsprogramme? Gibt es vielleicht Optimierungspotenzial? Im nächsten Newsletter: Die Dunkle Seite der Führung – und warum sie nicht ganz so dunkel bleiben muss!

Employee Experience (EX) ist längst kein flüchtiger Trend mehr – sie ist zur zentralen Stellschraube für Unternehmen geworden, die Fluktuation niedrig halten und Talente nicht nur gewinnen, sondern auch langfristig binden und entwickeln wollen. Und trotzdem besteht die akute Gefahr, dass EX sich in das verstaubte Regal der Bullshit-Bingo-Buzzwords wie VUCA-Welt, Agilität oder Work-Life-Balance gesellt. (Notiz am Rande: Wussten Sie, dass VUCA out ist und die coolsten der coolen Berater nun von BANI reden? Nein? Gut so, nix verpasst! Deshalb klären wir an dieser Stelle auch nicht auf, wofür BANI steht.) Doch was genau bedeutet dieser Begriff eigentlich? Was steckt hinter der Employee Experience und wie lässt er sich fundiert erfassen und gestalten? ________________________________________ 📌 Was ist „Employee Experience“? Die Employee Experience umfasst die Gesamtheit aller Eindrücke, Erlebnisse und Emotionen, die Mitarbeitende im Laufe ihrer Zeit mit einem Unternehmen machen – vom ersten Kontakt über den Arbeitsalltag bis zum letzten Tag. Anders als klassische, isolierte Konzepte wie „Mitarbeiterzufriedenheit“ oder „Engagement“ betrachtet EX den kompletten Lebenszyklus und ist systemisch gedacht : Sie ist das Ergebnis von unbeschönigten, gelebten Strukturen, Kultur, Kommunikation, Technologie und Führung. Darauf aufbauend ist dann zu überlegen, was an welcher Stelle zu verbessern ist. ________________________________________ 🔍 EX – Ansätze zur Operationalisierung Um die Tiefe der Employee Experience zu erfassen, lohnt es sich, auf bewährte psychologische Theorien zu blicken. Denn diese bieten konkrete Hinweise, wie Organisationen eine positive, aktivierende und nachhaltige EX gestalten können. ________________________________________ 1. Job Characteristics Model Das Job Characteristics Model (JCM) beschreibt, wie bestimmte Merkmale der Arbeit – etwa Bedeutsamkeit, Autonomie und Feedback – die intrinsische Motivation und damit das Erleben von Arbeit positiv beeinflussen. 🔗 Bezug zur EX: Eine gelungene Employee Experience sorgt dafür, dass Mitarbeitende ihre Aufgaben als sinnvoll, selbstwirksam und anerkannt empfinden. Ein gut gestalteter Arbeitsplatz ist nicht nur effizient, sondern psychologisch motivierend. Praxisfrage: Ist das Job Design in Ihrem Unternehmen darauf ausgerichtet, diese Merkmale zu fördern? ________________________________________ 2. Psychological Contract Theory Der psychologische Vertrag beschreibt die unausgesprochenen Erwartungen zwischen Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden. Wird dieser „Vertrag“ gebrochen – z. B. durch mangelnde Wertschätzung oder nicht eingelöste Entwicklungschancen – leidet das Vertrauen. 🔗 Bezug zur EX: EX ist nicht nur das, was man sieht – sondern vor allem das, was Mitarbeitende erwarten und erleben. Der Bruch zwischen Erwartung und Realität ist oft die Quelle von Frustration und Kündigungsabsicht. Praxisfrage: Wo könnten unausgesprochene Erwartungen in Ihrem Team aktuell enttäuscht werden? ________________________________________ 3. Self-Determination Theory Diese Motivationstheorie darf als eine der erklärungsmächtigsten Instrumente betrachtet werden und betont drei fundamentale psychologische Grundbedürfnisse: • Autonomie (selbstbestimmt handeln) • Kompetenz (sich wirksam fühlen) • soziale Eingebundenheit (Zugehörigkeit erleben) 🔗 Bezug zur EX: Eine exzellente Employee Experience erfüllt diese drei Grundbedürfnisse im täglichen Miteinander. Wenn Mitarbeitende sich gesteuert, isoliert oder überfordert fühlen, bricht diese Erfahrung ein – und mit ihr Engagement, Innovation und Loyalität. Praxisfrage: Inwiefern fördert das Arbeitsumfeld in Ihrem Team/Unternehmen diese drei Bedürfnisse? ________________________________________ 4. Touchpoint-Ansatz (aus dem CX-Management) Aus dem Customer Experience Management (CX) übernommen, betrachtet dieser Ansatz alle Kontaktpunkte (Touchpoints) eines Mitarbeitenden mit dem Unternehmen – vom Bewerbungsgespräch über das Onboarding bis hin zum Austritt. 🔗 Bezug zur EX: Jeder dieser Touchpoints ist ein emotionaler Moment. Wie gut er gestaltet ist – menschlich, wertschätzend, transparent – bestimmt maßgeblich, ob eine positive Employee Experience entsteht. Praxisfrage: Welche Touchpoints im Team/Unternehmen sind aktuell eher Hürden statt Highlights? ________________________________________ 🧩 EX ist kein HR-Projekt – sie ist ein unternehmenskultureller Prozess Employee Experience ist kein neues Tool, kein Software-Modul und keine HR-Unterabteilung. Sie ist ein ganzheitlicher Gestaltungsansatz, der sich durch Führung, Kommunikation, Prozesse und Kultur zieht. Wer EX nur als "Mitarbeiterzufriedenheit reloaded" versteht, verpasst das eigentliche Potenzial: Sie ist der systemische Ausdruck dessen, wie ernst Mitarbeiter im Unternehmen genommen werden. Und genau aus diesem Grund reicht es NICHT aus, wenn HR-Expertinnen von Employee Experience sprechen, das Management und die Führungskräfte des Unternehmens die Tragweite und eigene Rolle nicht erkennen und es als reine HR-Wortspielerei abtun! ________________________________________ ✅ So gestaltet HR die EX wirksam – 5 Handlungsempfehlungen 1. Denke systemisch: Nicht Einzelmaßnahmen, sondern das Zusammenspiel aller Faktoren – Unternehmenskultur und Führungskultur - formt die Experience. 2. Baue auf psychologische Grundbedürfnisse: Autonomie, Kompetenz und Verbundenheit sind keine „Nice-to-haves“, sondern essenziell. 3. Gestalte Touchpoints bewusst: Onboarding, Feedback, Konfliktgespräche, Weiterbildungsangebote, Total Compensation – hier zeigt sich, wie EX gelebt wird. 4. Messe mehr als nur Zufriedenheit oder den guten alten eNPS: Nutze Feedbackinstrumente, die tiefer gehen: z. B. zu psychologischer Sicherheit oder Werte-Fit. 5. Binde Führung ein: EX ist Führungsaufgabe – nicht nur ein Thema für HR. Führungskräfte gestalten Kultur in Echtzeit; Sie agieren als Vorbilder, aktive Gestalter und Multiplikatoren. ________________________________________ 💬 Fazit Employee Experience bleibt dann ein Insider-Buzzword, wenn nur HR davon spricht. EX wird nur dann zu einem Wettbewerbsfaktor und Kulturbarometer, wenn das Unternehmensmanagement und die Führungskräfte als Multiplikator agieren. Wird EX in der Unternehmens-DNA verankert, zeigen sich motiviertere Mitarbeiter, ein besseres Employer Branding und langfristige Mitarbeiterbindung. Teil der Wahrheit um EX ist aber auch, gute Unternehmen praktizierten es bereits, bevor es das Wort gab: EX ist also nicht neu – sie ist nur endlich in der Unternehmensrealität angekommen. ________________________________________ 💡 Wie bewusst ist die Employee Experience als systemischer Ansatz Teil Ihres HR-Managements und zeigt sich auch außerhalb von HR ernsthaft im Führungsalltag integriert? Welche Touchpoints sind besonders stark – und wo besteht Nachholbedarf? IM NÄCHSTEN NEWSLETTER: Führungskräfte-Weiterentwicklung Worauf es bei Gestaltung und Auswahl wirklich ankommt

Seit Jahrzehnten gelten Teams als das Nonplusultra moderner Organisationsgestaltung. Allerdings nur unter den Unwissenden! Sie stehen für Partizipation, Innovation, Flexibilität und überlegene Performance; vielleicht sogar für Selbst-Organisation. In agilen Modellen wie Scrum ist Teamarbeit sogar strukturell verankert. Doch je verbreiteter ein Konzept wird, desto mehr lohnt sich eine kritische Betrachtung: Sind Teams wirklich der Schlüssel zu besserer Leistung – oder wird ihre Bedeutung überschätzt? Kennen Sie evidenzbasierte Grundlagen, typische Missverständnisse und praktische Implikationen von Teamarbeit? ________________________________________ 🧠 Glauben wir nicht alle, dass... Teams bessere Problemlösungen hervorbringen? Mitarbeiter in Teams höher motiviert sind? Risiko in Teams besser eingeschätzt wird? heterogene (also diverse) Teams sind besser! Tja, leider FALSCH gedacht! Und falls Sie das obige nicht bereits wussten, verspüren Sie jetzt womöglich den Drang zu widersprechen. Schnell fallen Ihnen Beispiele aus der eigenen Praxis ein, die doch klar belegen, dass Sie eben doch richtig liegen, nicht wahr?! Diese Beispiele gibt es – unstrittig. Soweit die gute, versöhnliche Nachricht. Jedoch gibt es eben auch die anderen Beispiele! Die, von denen man nichts hört. Denn sie stören das verfälschte, aber weitverbreitete und allzu harmonische Bild von Teams als Allheilmittel. In Wissenschaft und Forschung hingegen ist schon länger recht unstrittig, dass Teams nicht selten die Entscheidungsqualität senken und/oder die Entscheidungsfindung zeitlich hinauszögern. In Summe, also alle bekannten Beispiele und Experimente berücksichtigend und ohne persönliche Vorlieben und Verzerrungen zeigt sich ein nicht wirklich rossiges Bild. Es gilt beim Thema Teams also, was schon immer und für alles galt: Die Wahrheit liegt in der Mitte und es kommt drauf an! (Sie wollen es immer noch nicht wahrhaben oder mehr darüber wissen? Es gibt zwei gute Bücher aus dem Springer Verlag. Bei Interesse einfach melden!) So richtig sicher in puncto Vorteile von Teams oder Teamarbeit ist sich die Wissenschaft vor allem bei komplexen oder neuen Problemen, wenn also Kreativität und Innovation gefragt sind. Dann übrigens entfaltet auch Diversität seine Stärken. In vielen anderen Situationen drohen Koordinationsverluste, Gruppendenken, Trittbrettfahrerverhalten, erhöhter Kommunikationsbedarf und erhöhte Konfliktgefahr. ________________________________________ ⚠️ Wann Teams nicht sinnvoll sind Teams werden oft reflexartig gebildet, obwohl sie nicht immer nötig oder sinnvoll sind. Problematisch ist das insbesondere bei: • Einfachen Aufgaben, die keine interdisziplinäre Zusammenarbeit erfordern • Hoch spezialisierte Aufgaben, die keine Zusammenarbeit, sondern nach absolutem Expertenstatus verlangen • Dringenden Entscheidungen, wo Abstimmung Zeit kostet • Hierarchischer Führungskultur, in der Teamarbeit nur simuliert wird • Fehlender Teamfähigkeit bei Mitgliedern oder Führungskräften ________________________________________ 🔑 Der Einsatz von Teams sollte strategisch und bewusst erfolgen – nicht als Standardlösung. Es ist also vor allem die Aufgabe und deren Notwendigkeit oder Eignung für Teamarbeit, die entscheiden. Es sind Organisationsstrukturen und Führungskultur, die den Einsatz und Erfolg bestimmen. Dementsprechend wäre es falsch, einseitig veraltete Strukturen und verkrustete Führungsfantasien für mangelnden Team-Erfolg verantwortlich zu machen. Denn nebst der Aufgabe trägt auch der unreflektierte Glaube an die Allmacht von Teams sowie der übertriebene Zeitgeist beim Thema Selbstorganisation und Laissez-faire nicht zum Erfolg von Teams bei. Wenn Teams nicht nur irgendwie funktionieren, sondern deutlichen Mehrwert liefern sollen, müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein: 1. Die Aufgabe entscheidet Manche Probleme können gut von einer einzelnen Person gelöst werden, Solange diese relevantes Wissen und notwendige Fähigkeiten besitzt. 2. Klare Ziele & Rollen Unklare Erwartungen führen zu Unsicherheit. Gute Teams wissen, wer was macht – und warum. 3. Psychologische Sicherheit Nur wer sich traut, offen zu sprechen, kann kreativ sein und Konflikte konstruktiv lösen (siehe Newsletter https://www.linkedin.com/pulse/psychologische-sicherheit-mut-zur-meinung-und-klmsf). 4. Teams und Diversität – richtig geführt Unterschiedliche Perspektiven sind dann wertvoll, wenn Kreativität oder Innovation gefordert sind – aber nur, wenn sie integriert werden und Spielregeln eingehalten werden. Sonst drohen Spannungen. 6. Gute Führung Teams brauchen keine Kontrolle, aber strukturgebende Führung – vor allem bei Zielklärung, Feedback, Reflexion und auch Entscheidung. 7. Effektive Kommunikation Missverständnisse, ungeklärte Erwartungen und fehlende Abstimmung sind häufige Ursachen für Teamversagen. Gerade in diversen Teams ist hierbei zu Beginn der Zusammenarbeit ein erhöhter Kommunikationsbedarf einzuplanen. ________________________________________ 💡 Es ist also ein Mythos, dass Teams immer besser wären als Einzelarbeit. Realität ist, dass Teams besonders bei kreativen und innovativen oder hoch komplexen Aufgaben stark sind. Doch wie viele Mitarbeiter im Unternehmen arbeiten (ständig) auf innovativen oder kreativen Hochtouren? Wie oft sind Aufgaben im Unternehmen so komplex und neuartig, dass diese nur im Team gelöst werden können? Wird also der Begriff des Teams auch in Ihrem Unternehmen inflationär gebraucht und übertrieben verherrlicht? Wäre es vielleicht angebracht, eine differenzierte Haltung einzunehmen, um damit Ziele nicht nur effektiver, sondern auch effizienter zu erreichen? Im nächsten Newsletter: Employee Experience - Alter Wein in neuen Schläuchen oder frischer Wind in alten Hallen?

Unternehmenskultur braucht Führung – und Strategie Wir alle kennen die berühmten Zitate à la „Culture eats strategy for breakfast.“ Und ja, das stimmt – wenn Kultur nicht mit Strategie verzahnt ist. Unternehmenskultur entsteht nicht in der Personalabteilung. Sie entsteht auch nicht im Führungskräfte-Meeting. Sie entsteht im Zusammenspiel – dort, wo strategisches HR-Management und Leadership gemeinsam wirken. In Zeiten von Arbeitskräftemangel, Sinnsuche und beschleunigtem Wandel ist klar: Kultur ist kein Nice-to-have mehr, sondern ein Überlebensfaktor. Hierzu gab es bereits einen Newsletter: https://www.linkedin.com/pulse/unternehmenskultur-kein-weicher-faktor-sondern-ykbyf Doch genau hier liegt oft das Problem – denn HR und Führungskräfte agieren zu häufig nebeneinander statt miteinander. Wenn es ganz dumm läuft, glauben die Falschen es besser zu wissen und die eigentlich richtigen sind letztlich froh, sich diesen Schuh nicht auch noch anziehen zu müssen. ________________________________________ Schulterschluss – was heißt das konkret? Ein funktionierender Schulterschluss zwischen HR und Führungskräften bedeutet: • gemeinsame Verantwortung für Unternehmenskultur und Mitarbeitererlebnis, • strategische Abstimmung zu Zielen, Werten und Prioritäten, • und eine vertrauensvolle, dialogorientierte Zusammenarbeit im Tagesgeschäft. Es geht nicht um „HR als Supportfunktion“ oder „Führung als Kulturbotschafter“. Es geht um partnerschaftliches Co-Leadership für die Kultur – auf Augenhöhe. ________________________________________ Warum dieser Schulterschluss bisher zu selten gelingt Viele Unternehmen scheitern nicht am Wollen, sondern an Strukturen und Missverständnissen, oft zeigt sich: 🔸 HR ist im operativen Alltag gefangen 🔸 HR sieht sich zwar als Kulturträger – aber wird von Führung nur punktuell eingebunden 🔸 Führungskräfte sollen Kultur (vor-)leben – erhalten aber keine passenden Tools oder Rückhalt 🔸 Strategisches HR-Management existiert – aber ohne Verankerung im Leadership-Alltag 🔸 Führungskräfte sind es nicht gewohnt, auch strategisch mit HR zusammenzuarbeiten Ergebnis: Kultur bleibt abstrakt, Initiativen verpuffen, Mitarbeiter bleiben unterfordert oder unverbunden. Was fehlt, ist das gemeinsame Wirken. ________________________________________ So gelingt der Schulterschluss: 6 Handlungsfelder für HR + Führung 1. Kultur zur gemeinsamen Sache machen Kultur darf nicht isoliert im People & Culture-Bereich bearbeitet werden – sondern muss strategisch in die Unternehmensführung eingebettet werden und somit auch die einzelne Führungskraft erreichen. ✅ Tipp: Initiieren Sie gemeinsame Kultur-Offensiven – mit klar definierten Verantwortlichkeiten, Projektteams aus HR und Führung und einem Schulterschluss auf C-Level. Kultur gehört in die Unternehmensstrategie, nicht ins Feierabendformat. ________________________________________ 2. HR-Strategie mit Business-Zielen verzahnen HR muss sich vom operativen Reagieren hin zum strategischen Business Partner entwickeln. Obstkörbe sind zweifelsfrei ne feine Sache, aber auf der Ebene des Top-Management zählen dann eben doch andere, harte KPIs. Welche strategische KPI´s an HR in Ihrem Unternehmen? Führungskräfte wiederum müssen erkennen: HR ist nicht nur "Service", sondern wichtiger Treiber Mitgestalter des Erfolgs. ✅ Tipp: Entwickeln Sie eine integrierte People-Strategie, die auf Business-Ziele einzahlt. Laden Sie Führungskräfte gezielt zur Mitgestaltung ein – z. B. bei Talentstrategien, Entwicklungsarchitekturen oder Employer Branding. ________________________________________ 3. Kulturindikatoren gemeinsam definieren und messen Was wird gemessen, wird wichtig. Definieren Sie gemeinsam mit Führungskräften messbare Kulturziele, z. B.: • psychologische Sicherheit, • Führungsqualität, • Teamzufriedenheit oder • Entwicklungschancen. ✅ Tipp: Führen Sie regelmäßige Culture Checks oder Pulsbefragungen durch – und leiten Sie gemeinsam Maßnahmen ab. HR liefert die Datenbasis, Führung sorgt für Umsetzung im Alltag. ________________________________________ 4. Leadership Development neu denken Führung ist Kulturarbeit. Doch zu oft fehlen gezielte Angebote, wie Führungskräfte zu echten Kulturträger:innen werden können. ✅ Tipp: Entwickeln Sie gemeinsam ein Leadership-Programm, das Kulturkompetenz in den Fokus stellt: • Wie fördere ich Vertrauen? • Wie gestalte ich Entwicklungsgespräche sinnvoll? • Wie gehe ich mit Widerspruch um? Lernen Sie voneinander: HR kennt die Konzepte – Führung bringt den Alltag ein. DAS IST NOTWENDIG, aber nicht umfänglich hinreichend! Leadership Development bedeutet auch, (Nachwuchs-)Führungskräfte adäquat auszubilden. Hier zeigt sich gerade bei KMUs eine nicht länger akzeptable Lücke. ________________________________________ 5. Gemeinsame Kommunikation etablieren Wenn HR und Führung sich regelmäßig austauschen, können Themen wie Mitarbeiterbindung, Entwicklung oder Veränderungsbereitschaft frühzeitig erkannt und angegangen werden. ✅ Tipp: Etablieren Sie ein festes HR-Führungsgremium – ob monatlich oder quartalsweise. Tauschen Sie sich nicht nur über Maßnahmen, sondern auch über Stimmungen, Trends und blinde Flecken aus. ________________________________________ 6. Erfolge sichtbar machen Kultureller Wandel bleibt oft unsichtbar. Machen Sie Fortschritte und Positivbeispiele gemeinsam sichtbar – in internen Newslettern, Townhalls oder Learning Cafés. ✅ Tipp: Zeigen Sie, wo der Schulterschluss wirkt: • Ein Team hat seine Meetingkultur verändert. • Eine Führungskraft initiiert ein offenes Feedback-Experiment. • HR und Führung entwickeln gemeinsam ein neues Onboarding-Erlebnis. Das inspiriert – und stärkt die kulturelle Bewegung im Unternehmen. ________________________________________ Der strategische Gewinn: Kultur wird zur Wertschöpfungskraft Wenn HR und Führungskräfte zusammenarbeiten, passiert etwas Entscheidendes: Unternehmenskultur wird kein abstraktes Ideal, sondern ein konkreter Wettbewerbsfaktor. 🎯 Strategisches HR-Management erkennt: Mitarbeitende sind keine „Ressourcen“, sondern Mitgestalter der Zukunft. 🎯 Moderne Führung erkennt: Erfolg entsteht nicht durch Kontrolle, sondern durch Vertrauen und Entwicklung. 🎯 Gemeinsam wird deutlich: Kultur ist keine schöne Fassade – sondern das Fundament für Performance, Innovation und Bindung. HR fungiert dementsprechend als Architekt der Unternehmenskultur: HR legt beim Thema Unternehmenskultur – basierend auf den vom oberen Management ausgearbeiteten Unternehmenswerten - die Rahmenbedingungen fest (z. B. durch Benefits, Diversity-Programme, Feedback-Kultur) und achtet vor allem bei der Selektion neuer Mitarbeiter nicht nur auf den Person-Job-Fit (P-J-Fit), sondern verstärkt auf den womöglich wichtigeren P-O-Fit (Person-Organisation-Fit): Denn es ist schichtweg einfacher, einem Mitarbeiter neues Wissen oder neue Fertigkeiten beizubringen, als seine grundlegende Einstellung zu ändern! Sie achtet darauf, dass neue Talente sowohl fachlich als auch kulturell zur Organisation passen. Basierend auf den Unternehmenswerten entwickelt HR-Verhaltenskodizes und -Programme, die die gewünschte Unternehmenskultur fördern. Letztlich wird mit Schulungen und Workshops seitens HR dafür gesorgt, dass alle Mitarbeitenden und Führungskräfte die Kultur verstehen und leben können. Führungskräfte als Vorbilder und Treiber im Arbeitsalltag Verhalten prägt Kultur: Führungskräfte leben die Unternehmenswerte vor. Ihre Handlungen und Entscheidungen wirken wie ein Spiegel, an dem sich Mitarbeitende orientieren. Zudem schaffen sie durch Kommunikation, Feedback und Anerkennung ein Umfeld, in dem sich Mitarbeitende wertgeschätzt fühlen und sich aktiv einbringen können: Anerkennung oder gar Belohnung werden eng mit den Werten des Unternehmens verbunden. Entscheidungen unter Einbezug einer unternehmenskulturellen Perspektive getroffen. So setzen Führungskräfte Standards für den Umgang mit Konflikten, die Transparenz von Entscheidungen und die Priorisierung von Zielen. Im Ergebnis stärkt dies das psychologische Sicherheitsgefühl der Mitarbeitenden – ein wesentlicher Faktor für eine gute Unternehmenskultur. Fazit Der oben beschriebe Schulterschluss ist kein „Nice-to-have“, sondern ein entscheidender Erfolgsfaktor. Er beeinflusst nicht nur, wie gut ein Unternehmen arbeitet, sondern auch, wie es von innen und außen wahrgenommen wird. Kurz gesagt: Eine starke Kultur ist der Schlüssel zu glücklichen Mitarbeitenden, loyalen Kunden und einem gesunden Unternehmen. Dabei legt HR den Grundstein für die Kultur, während Führungskräfte diese im Alltag umsetzen und leben. Zusammen schaffen sie ein Umfeld, das Zusammenarbeit, Innovation und Zufriedenheit fördert – und das ist entscheidend für den langfristigen Erfolg eines Unternehmens. Also, was können HR und Führungskräfte in ihrem Unternehmen GEMEINSAM aktivieren, damit Unternehmenskultur und Leadership Development mehr als nur ausreichend gestärkt wird? Im nächsten Newsletter: Teams - Heilsbringer oder Hype, Motor oder Mythos?